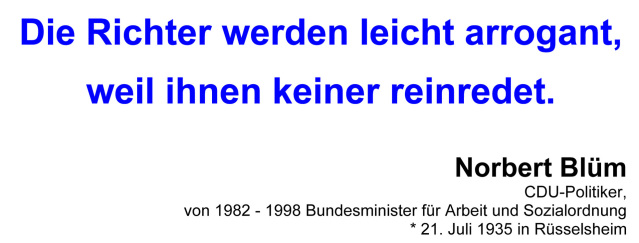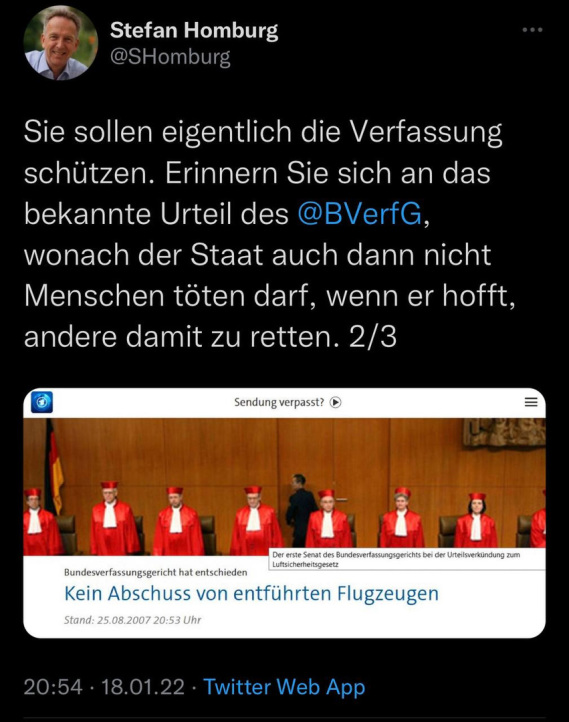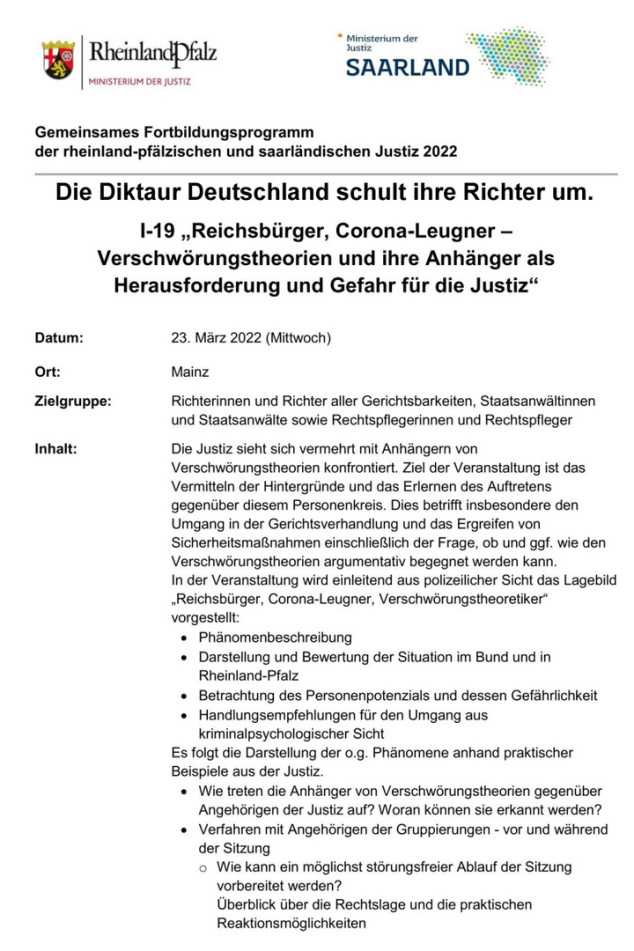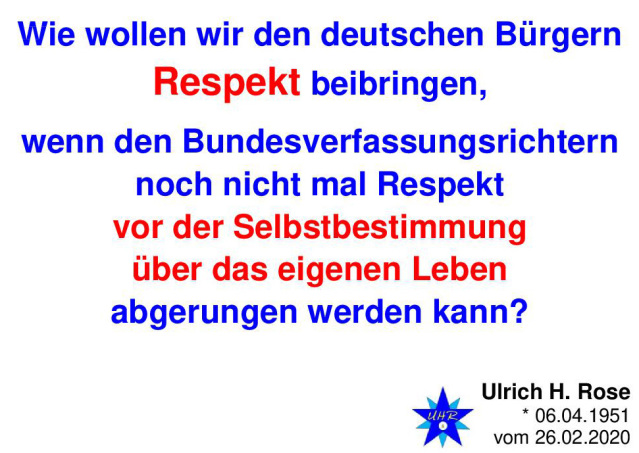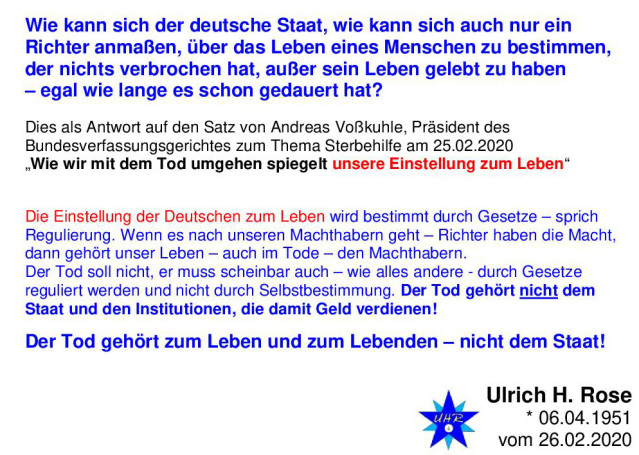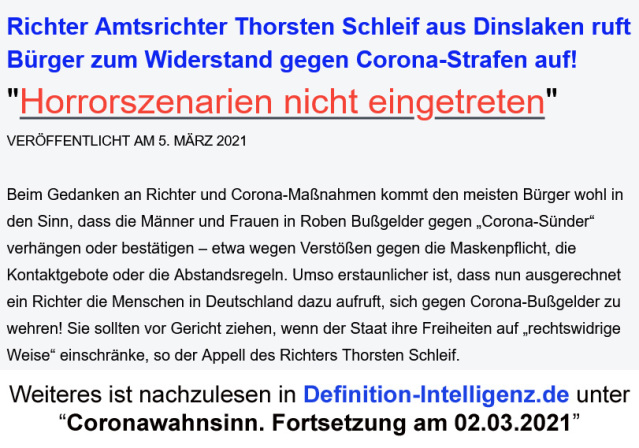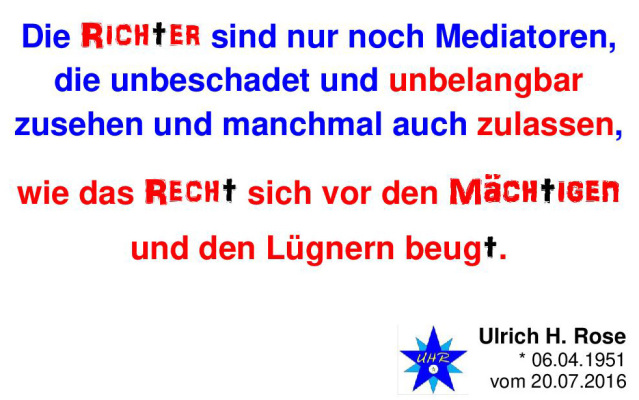Vom Rechtsstaat in den Richterstaat
Hierher übertragen am 15.05.2022
Ulrich H. Rose vom 8.01.2011
Vom Rechtsstaat in den Richterstaat?
von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Simon vom 3. November 2008*
* Vortrag gehalten am 3. November 2008 im Rahmen der Vortragsreihe des Berliner Arbeitskreises Rechtswirklichkeit (http://www.rechtswirklichkeit.de). Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Simon war neben
seiner Professur für Zivilrecht und Römisches Recht an der Universität Frankfurt am Main unter anderem Direktor am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main),
Vorsitzender des Wissenschaftsrats und Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
aktuelle Daten vom Jan. 2011 über Dieter Simon:
Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät
D-10099 Berlin dieter.simon@rewi.hu-berlin.de
geb. 7. Juni 1935 Ludwigshafen/Rh.
Studium der Jurisprudenz, Geschichte und Philosophie in Heidelberg und München
1959 / 1964 Erstes bzw. Zweites Juristisches Staatsexamen
1962 Promotion zum Dr. iur. (juristische Papyrologie)
1964–1967 Wissenschaftlicher Assistent (bei Wolfgang Kunkel) an der Ludwig-Maximilians-Universität München
1967 Habilitation (spätantikes Prozessrecht)
1968–1991 Lehrstuhl für Zivilrecht und Römisches Recht an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
1974 Gründung des Forschungsprojekts »Byzantinisches Recht« (DFG, seit 1990 an der Akademie der Wissenschaften, Göttingen)
1980–6/2004 Direktor am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main
seit 7/2004 emeritiertes wissenschaftliches Mitglied des MPIER, Frankfurt/Main
Forschungsaufenthalte am Collège de France (Paris), am Historischen Kolleg (München), in Dumbarton Oaks (Washington, D.C.), und bei der Robbins Religious and Civil Law Collection, University of
California at Berkeley
1985–1992 Mitglied des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland
1988 Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates
1989–1992 Vorsitzender des Wissenschaftsrates
1995–2005 Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
seit 1996 Honorarprofessor der Humboldt-Universität zu Berlin
Vom Rechtsstaat in den Richterstaat
Mein Bericht bezieht sich auf eine schon etwas zurückliegende Kontroverse, die, wie es zunächst schien, kaum mehr als
eine semantische Differenz zum Gegenstand hatte, nämlich die Frage, ob man bei bildhafter Kennzeichnung des Richteramtes noch von einem Diener des Gesetzes sprechen könne oder nicht. Als die
Auseinandersetzung das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erreichte, war sie allerdings schon zu einer expressiven Debatte über das Richterrecht erstarkt.
Das ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Die deutsche Rechtstheorie hatte schon immer ihre besonderen Schwierigkeiten mit dem Richterrecht. Bereits die Anerkennung des Umstandes, daß es so etwas wie
Richter-Recht, also von der Justiz im Entscheidungswege gesetzte Normen, überhaupt gibt, so daß man sich theoretisch mit diesem Phänomen auseinandersetzen muss, ist ihr schwer gefallen. Die Aufnahme
des Richterrechts unter die „Rechtsquellen“, also jenen Pool an Normen, aus dem der Entscheider die Prämissen für sein Urteil schöpfen darf, ist bis heute umstritten, – übrigens ohne daß jemals der
Widerspruch zur zeitgenössischen Methodenlehre thematisiert würde, die unerbittlich die gründliche Auseinandersetzung mit höchstrichterlichen Entscheidungen zur Voraussetzung für eine akzeptable
Falllösung macht.
Was jedoch an dieser Debatte auffiel war, abgesehen davon, daß sie in einer Tageszeitung stattfand, ein Quartett ungewöhnlicher Konstellationen.
Erstens handelte es sich um ein Wortgefecht zwischen Praktikern und Theoretikern, zwischen Richtern und Professoren. Das gehört in der Bundesrepublik durchaus zu den Ausnahmen. Die
verschiedenen Segmente der Teilnehmer am Rechtsdiskurs debattieren lieber untereinander in ihren je eigenen Fachzeitschriften als miteinander und in der Medienöffentlichkeit.
Zweitens entzündete sich das Streitgespräch nicht an einer ausgefeilten rechtstheoretischen Positionsbestimmung, sondern an
einem fast beiläufigen „Zwischenruf“, auf den vermutlich niemand geachtet hätte, wäre er nicht vom Präsidenten des Bundesgerichtshofs Günter Hirsch ausgestoßen worden.
Drittens handelte es sich um die einmalige Situation, daß offenkundig weit weniger bestimmte Sätze als gewisse sprachliche
Bilder die Polemik ausgelöst hatten: Soll die Metapher vom Richter als „Diener des Gesetzes“ durch die treffendere und modernere vom Richter als Pianisten vor der Partitur des Gesetzes ersetzt
werden?
Viertens ergab sich die Pikanterie, daß die Richterseite mit falschen Argumenten für das Vernünftige stritt, nämlich für
eine angemessene Neubewertung des Richterrechts, während die Professorenseite mit richtigen Argumenten für das Unhaltbare kämpfte, nämlich für ihren erschöpften und unerfüllbaren Traum von der
richterlichen Gesetzesbindung.
I.
Inzwischen haben sich weitere Akteure in die Debatte eingemischt wie etwa der Kölner Verfassungsrechtler Martin Kriele und Winfried Hassemer, der gleich in dreifacher Rüstung auftrat, als Professor,
als Richter und als Mann aus dem Hofstaat unseres Ersatzkaisers, dem Bundesverfassungsgericht.
Das alles deutet daraufhin, daß hier eine Konstellation zur Sprache gekommen ist, bei der es um mehr geht als um die richtige Bebilderung gesellschaftlich prominenter Funktionäre, wie sie die Richter
zweifellos darstellen.
Tatsächlich hat der Rechtswissenschaftler und Rechtstheoretiker Bernd Rüthers den Disput mit einer dramatischen Spitze versehen. Er konstatierte einen „schleichenden Verfassungswandel“, ausgelöst durch „die fortschreitende Machtverschiebung in der Rechtsetzung, von der
Gesetzgebung auf die Justiz, speziell auf die obersten Bundesgerichte“.
Warum dieser Wandel, wenn er uns denn tatsächlich beschleichen sollte, vom Übel ist, hat Rüthers nicht näher begründet. Das war auch nicht
erforderlich, denn die Gründe gehören zum Bildungswissen jedenfalls jener Bürger, die die Frankfurter Allgemeine lesen: Die Richterschaft ist zur Gesetzgebung nicht demokratisch legitimiert.
Der Souverän hat Aufgabe und Macht zur Rechtsetzung in die Hände seiner gewählten Vertreter, das Parlament, gelegt, das dem Volk für die Art und Weise, wie es diese Macht ausübt, Rechenschaft
schuldet. Der Richter schuldet, solange er den Rahmen seiner dienstlichen Obliegenheiten nicht verletzt,
niemandem irgendetwas. Er ist nur an die Abstrakta „Recht und Gesetz“ gebunden.
Wie aber ist es zu dieser leisen Entmachtung des Gesetzgebers und dementsprechend zum Machtgewinn der obersten Bundesgerichte gekommen?
Rüthers hat dafür zwei Ursachen entdeckt.
Die Gesetzgebung, so sagt er, kommt ihren Regelungsaufgaben nur unzulänglich nach. Warum die Parlamentarier ihre Aufgaben so schlecht erfüllen beruht, so Rüthers, wiederum auf zwei sehr verschiedenen
Gründen.
Der erste Grund ist die Veränderungsgeschwindigkeit der Moderne, kombiniert mit der unvermeidlichen institutionellen Trägheit des Gesetzgebungsapparates, der lediglich in extremen Ausnahmesituationen
kurzfristig und zielgenau reagieren kann.
Berühmteste Ausnahme war bisher das Kontaktsperregesetz, das die RAF-Anwälte von ihren Mandanten ausschloss. Es lag als Entwurf am Mittwoch dem 28.09.1977 dem Bundestag vor, wurde am gleichen Tag
ohne Aussprache in den Rechtsausschuss überwiesen und am Folgetag, dem Donnerstag, nach zweiter und dritter Lesung beschlossen. Am Freitag um 9.30 Uhr stimmte der Bundesrat zu und der Bundespräsident
Walter Scheel unterschrieb es am Freitag kurz vor 10 Uhr. Dieser Rekord ist erst jetzt durch das Bundesgesetz zur Hilfe in der Bankenkrise fast eingestellt worden.
Das Normalverfahren nimmt sich etwas mehr Zeit. Und seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das Nachhinken des Gesetzgebers ein vielfach beobachteter und bis zum Überdruß
beschriebener Sachverhalt, der die naturgegebene Konstante, daß die gesellschaftlichen Konflikte ohnehin schon immer zunächst beim Richter aufliefen bevor sie den Gesetzgeber erreichten, längst in
den Schatten gestellt hat.
Neben dem Grund, daß der Gesetzgeber nicht schneller reagieren wird als er kann, steht der Umstand, daß er vielfach nicht will, obwohl er
vielleicht könnte.
Vom „dilatorischen Formelkompromiß“, mit dem Carl Schmitt einst trefflich die gesetzgeberische Verschiebung parlamentarisch unlösbarer Sachkonflikte an die Adresse der Justiz kennzeichnete,
bis zu der bekannten Formel, die Auffindung handhabbarer Kriterien – oder das gern so genannte „Nähere“ – könne und solle der richterlichen Praxis überlassen bleiben, zieht sich ein ununterbrochener
Delegationsstrom vom (eigentlich berufenen) Gesetzgeber auf den (eigentlich nicht berufenen) Richter durch die jüngere Justizgeschichte.
Wenn nun freilich der Gesetzgeber die ihm zugedachten Aufgaben entweder nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will – und dies nicht gerade erst seit einigen Jahren – stellt sich die Frage,
was die Rede vom schleichenden Verfassungswandel, der in diesem Kontext nach justizieller Machterschleichung schmeckt, eigentlich besagen soll. Der Richter steht unter Entscheidungszwang. Er kann und
darf nicht warten, bis ihm der Gesetzgeber eine Vorlage liefert, während der Gesetzgeber bekanntlich gerade umgekehrt mit einer gewissen Vorliebe einige Entscheidungen abwartet, um nach ihrem Muster
sein Gesetz zu basteln.
Die Machtverschiebung findet in diesem Zusammenhang offenbar weitgehend mit Zustimmung der Beteiligten statt, denen anscheinend mehr am Funktionieren des Staatsapparates gelegen ist als am Prinzip
der Gewaltenteilung. Soll man sie wegen Prinzipienverstoßes tadeln – wobei der Gesetzgeber fraglos den strengeren Verweis zu gewärtigen hätte – oder sollte man zur Abwechslung nicht einmal das
Gewaltenteilungsprinzip einer kritischen Revision unterziehen? Die so außerordentlich beliebte Verordnung, d.h. eine durch die dazu delegierte Exekutive gesetzte Norm aufgrund eines Gesetzes
gilt schließlich auch als demokratietheoretisch unverdächtig, obwohl die Legitimationsbasis nicht über jeden Zweifel erhaben ist und von einer Gewalt in Anspruch genommen wird, der dies nach
Gewaltenteilungsrecht gerade nicht zukommt.
II.
Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, dürfte es zweckmäßig sein, noch die zweite, von Rüthers und seiner Gefolgschaft ausfindig gemachte Ursache für den „schleichenden Verfassungswandel“ vom
Rechtsstaat in den Richterstaat in die Erörterung einzubeziehen.
Bei ihr handelt es sich in dem Verhältnis zwischen Gesetzgeber und Richter gleichsam um ein Korrespondenzvergehen der Richterschaft. Während der Gesetzgeber seine Aufgabe nicht so erfüllt wie
er sollte, erfüllt der Richter Aufgaben, die er nicht erfüllen sollte: Er produziert eine Flut von Richterrecht, das, wieder „angewendet“, den Gesetzgeber verdrängt.
Sogar der Präsident des Bundesgerichtshofs, so Rüthers, vertrete die These, der Richter könne gegebenenfalls vom vorhandenen geltenden Gesetz abweichen, womit er „eine neue Verhaltensnorm für die
Justiz aufgestellt“ habe.
Tatsächlich hat Günter Hirsch in einer Rede vor Absolventen des juristischen Staatsexamens festgestellt: „Würde die wortgenaue Anwendung der Norm zu ungerechten oder sachwidrigen Ergebnissen
führen, ist das Feld für die Setzung von Richterrecht geöffnet“ – eine Formulierung, die er in dem inkriminierten „Pianisten-Zwischenruf“ mit dem abstrakteren Postulat abrundete: „Im Konfliktfall
(scilicet: zwischen Recht und Gesetz, DS) hat der Richter seine Entscheidung am (überpositiven) Recht auszurichten, der Positivismus als bedingungsloser Gehorsam gegenüber dem Gesetz ist
überwunden“.
Diese Legitimierung des Richterrechts mit einer Abwendung vom Gesetzespositivismus bei gleichzeitiger Hinwendung zu einem (wo auch immer verorteten) überpositiven Recht hat den
besonderen Grimm von Rüthers erregt und Hirsch eine geballte Ladung rechtshistorisch und rechtstheoretisch argumentierender Kritik eingebracht. Wobei die Argumente von Rüthers durchweg den
Behauptungen von Hirsch deutlich überlegen sind.
Daß der Positivismus als Wegbereiter und Gehilfe der Rechtsprechungsschurkereien im „Dritten Reich“ in Betracht gezogen werden dürfe, hat schon früh der spätere Präsident des
Bundesverwaltungsgerichts Franßen mit eindrucksvollen Gründen bestritten. Bernd Rüthers hat die 1946 von Radbruch in die Welt gesetzte These in den 70ern mit seinem Buch „Unbegrenzte Auslegung“
minutiös wissenschaftlich widerlegt. Seitdem wird sie in der Forschung nicht mehr vertreten und ihre Wiederholung in der Gegenwart wird zu Recht als ein Zeichen peinlicher Uninformiertheit
gewertet.
Nicht viel besser steht es mit Hirschs ebenso selbstbewusster wie naiver Berufung auf das überpositive Recht. Rüthers braucht hier nur auf wenige Gesichtspunkte aus der jetzt schon Jahrhunderte alten
Naturrechtskritik hinzuweisen (wer hat das Naturrecht geschaffen? welchen definierten Inhalt hat es? wie wird es erkannt?), um einen argumentativen Sieg verbuchen zu können. Seine geringschätzigen
Vokabeln („vermeintlich seherische Qualitäten der letzten Instanzen“), seine Zweifel („wo finden es die Gerichte außer in ihren jeweils variablen subjektiven Vorstellungen?“) und seine Demaskierungen
(„interpretative Vernebelungstrategien, um aus einem Gesetz herauszulesen, was man selbst vorher eingelegt hat“) stellen sich rasch und gleichsam von selbst ein.
Auf den leicht indignierten moralischen Hinweis von Rüthers, daß der – von Hirsch in servile Dienerschaft umgedeutete – „denkende Gehorsam“ des Philipp Heck womöglich (angesichts berühmter
historischer „erster Diener“ ihres Staates wie Friedrich II.) nicht vollständig obsolet sein möchte, kommt es bereits nicht mehr an. Die Pianisten-Metapher scheint verfehlt und
erledigt.
III.
Ganz so einfach ist die Sache bei näherer Betrachtung dann allerdings doch nicht. Denn die beiden Parteien argumentieren gegeneinander in einem wissenschaftlichen Paradigma, das von einer modernen
sprachwissenschaftlich aufgeklärten Methodologie und Rechtstheorie zweifellos als überholt und nicht mehr vertretbar angesehen würde.
Dieses Paradigma ist einerseits durch die misslungene Vernaturwissenschaftlichung der Jurisprudenz und ihre dazugehörige – erkenntnistheoretisch statt argumentationstheoretisch orientierte –
essentialistische Methodologie gekennzeichnet und zielt andererseits justizpolitisch immer noch auf den obrigkeitsstaatlichen Frühkonstitutionalismus.
Beide Kontrahenten gehen von der durch Verfassung und Richtergesetz sanktionierten Gesetzesbindung aus, in der sie einen Grundpfeiler der rechtsstaatlichen Ordnung sehen. Nur daß der eine (Rüthers)
jegliche Lockerung für den Anfang vom Ende des Rechtsstaats, der andere (Hirsch) die fallweise Verabschiedung dieses Gebots für ein Postulat der Einzelfall-Gerechtigkeit zu halten geneigt ist.
Tatsächlich ist die Gesetzesbindung jedenfalls insofern ein zentraler Aspekt des Rechtsstaates, als nur die inhaltliche Determinierung der gerichtlichen Entscheidung durch das im parlamentarischen
Verfahren zustande gekommene Gesetz geeignet ist, dem Prinzip der Gewaltenteilung einerseits, dem demokratischen Legitimationsbedarf der Richtermacht andererseits, Genüge zu tun. Außerdem gilt die
Bindung als natürlicher Preis für die richterliche Unabhängigkeit. Die Exekutive darf nicht dreinreden, damit der Richter nicht ihr, sondern nur dem Gesetz unterworfen ist.
Offenkundig und unstrittig kann das Bindungspostulat aber die erwähnten Leistungen nur erbringen, wenn es möglich ist, den Sinn, die Bedeutung des Gesetzes erstens methodisch und zweifelsfrei
zu ermitteln und zweitens den Entscheider an das festgestellte Ergebnis zu binden.
Um es mit Karl Heinrich Gros und seinem Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft von 1802 zu sagen:
„Ist der Sinn eines Gesetzes mit Gewissheit ausgemittelt, so muss der Richter dasselbe genau, wie es lautet, anwenden, wenn ihm auch die Verordnung desselben hart oder
unzweckmäßig scheinen sollte; denn der Richter soll nicht über die Gesetze, sondern nach den Gesetzen richten.“
Gegen die Realisierbarkeit dieses Konzepts wurden schon sehr früh, nahezu gleichzeitig mit den ersten Skizzen des Modells, erhebliche Zweifel ins Feld geführt. Die Unklarheiten, Lücken, Widersprüche
und sonstigen Defizite des Normenapparates waren schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts ebenso evident, wie die Unmöglichkeit die gerechtigkeitspolitischen Absichten der Entscheider, das berühmte
„voluntative Element“ gänzlich hinter dem Gesichtspunkt der „Anwendung“ eines Vorgegebenen verschwinden zu lassen.
Dieser Zustand hat sich in den letzten zwei Jahrhunderten ständig verschärft. Der Gesetzesstoff hat sich einerseits vermehrt und dabei notwendig qualitativ erheblich verschlechtert und ist
andererseits in wichtigen Bereichen fast völlig unter den Tisch gefallen, so daß die Rechtsprechung sich in diesen Bereichen heute am eigenen Zopf aus dem Sumpf der Kasuistik ziehen
muß.
Erklärung von UHR:
Kasuistik (lat. casus: "Fall") bezeichnet allgemein die Betrachtung von Einzelfällen in einem bestimmten Fachgebiet.
In der Rechtslehre etwa ist mit Kasuistik die Betrachtung eines einzelnen Falles gemeint, der vor Gericht entschieden wurde und bei neueren Fällen zu berücksichtigen ist, gerade dann, wenn allgemeine
Rechtssätze zur Definition eines Straftatbestandes nicht ausreichen. In Theologie und Philosophie ist die Betrachtung eines Einzelfalls etwa in Ethik oder Morallehre gemeint. Auch die spitzfindige
Theologie der Jesuiten wird als Kasuistik bezeichnet.
In der Medizin nennt man die oft paradigmatische und propädeutisch wichtige Fallbeschreibung, aus der allgemeine Lehrsätze abgeleitet werden können, eine Kasuistik.
Die hermeneutisch orientierte Soziologie wendet kasuistische Methoden an, wenn einzelne Fälle analysiert und interpretiert werden. Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Kasuistik“
Es ist kaum übertrieben, wenn man die methodologischen Anstrengungen unserer Theoretiker in den verflossenen 200 Jahren allesamt der letztlich vergeblichen Anstrengung
zuordnet, mit der mehr und mehr begriffenen Unmöglichkeit einer Bindung dergestalt fertig zu werden, daß die faktische Nichtbindung als methodisch reflektierte Bindung dargestellt und notfalls sogar
von allen Beteiligten geglaubt werden kann.
Nur vor diesem politischen und wissenschaftlichen Hintergrund sind die seltsamen und allesamt gescheiterten Scharfsinnigkeiten der Methodologen überhaupt zu begreifen.
Zum Beispiel:
Die Hierarchisierungsprogramme für die Auslegungscanones, bei denen herausgekommen ist, daß man zweckmäßig mit dem Wortlaut beginnen sollte, aber nicht muß, und daß man den Willen des Gesetzgebers
ermitteln soll, wenn man kann, aber nicht muß, wenn er einem nicht gefällt, weil dann die objektive Auslegung ihre Hilfe anbietet
Die weithin aufgefächerte Lückensemantik, mit ihren planmäßigen und planwidrigen Lücken, den offenen und verdeckten, den echten und unechten, bewussten und unbewussten, primären und sekundären, den
Normlücken, Gesetzeslücken, Rechtslücken, Kollisionslücken usw. – eine unendliche pathologische Litanei, die jedoch nicht verbergen kann, daß der mit dem Lückenbegriff notwendig in Anspruch genommene
Gedanke der Vollständigkeit jeglichen sachlichen Fundamentes entbehrt.
- die verzweifelten Bemühungen, die teleologische Interpretation einleuchtend von der Analogie abzugrenzen und damit aus dem Bereich des Geschmacksurteils herauszuführen,
- die platonischen Ontologisierungen einer angeblichen Wortlautgrenze, obwohl spätes¬tens seit Wittgenstein, die Bedeutungstheorien zu der Einsicht zurückgekehrt sind, daß
- die Bedeutung eines Ausdrucks im Gebrauch und nicht im Wort steckt, so wie die Farbe der Rose nicht in dieser, sondern im Auge des Betrachters gesucht werden muß ….
Diese und mancherlei andere Anstrengungen sollten wenigstens für die „Rechtsanwendung“ die Quadratur des Kreises ermöglichen: Die Unmöglichkeit der Bindung durch methodische Prozeduren als Erfüllung
des Bindungspostulats erscheinen zu lassen und darstellbar zu machen.
Der ständig radikaler und grundsätzlicher gewordenen Kritik waren alle diese Mühen am Ende doch nicht gewachsen. Gleichgültig ob sie sich heute auf Niklas Luhmann, auf Friedrich Müller, die
postmodernen Franzosen oder die neopragmatischen Angelsachsen berufen: Die Formel, daß der Richter mit dem beunruhigenden Paradoxon zu leben habe, daß er erst jene Bindung herstellt, an die gebunden
zu sein er anschließend erklärt, gehört heute zur Grundausstattung aller jüngeren Methodologen.
In anderen Fassung: Der Richter erzeugt schon aufgrund seiner ungemein schwierigen Aufgabe das Abstrakt-Allgemeine mit dem Konkret-Individuellen zu vermitteln nicht nur ausnahmsweise, sondern
in jedem Fall die Norm, unter die er anschließend und gleichzeitig den ebenfalls von ihm als solchen hergestellten Fall subsumiert.
Die Metapher von den kreativen Pianisten ist daher so schlecht gegriffen nicht.
IV.
Über die Frage, was diese Einsicht für Recht und Richter bedeuten könnte, wird bislang nur wenig nachgedacht. Das liegt in erster Linie an dem Umstand, daß das Paradoxon als typische
postpositivistische Erkenntnis in der Regel nur im engen Zusammenhang mit einer Kritik an der klassischen Rechtsanwendungslehre formuliert wird und die großräumigeren Perspektiven der Rechtstheorie
nicht erreicht. Außerdem wird der Ausdruck Bindungsparadox gern als befriedigende Erklärung eines Zustandes angesehen, den er lediglich bezeichnet.
In unserem Zusammenhang würde sich zunächst ergeben, daß die Rede vom Richterrecht obsolet geworden ist.
Wenn eine Rechtsnorm (wie sich etwa Friedrich Müller äußert) vor ihrer Formulierung durch den Richter überhaupt noch nicht existiert, sondern wenn sie erst durch die richterliche Arbeit(z. B.
mit Hilfe des Normtextes) ermittelt wird, dann ist es wenig förderlich von „Richterrecht“ als Alternative zum „Gesetzesrecht“ zu sprechen.
Denn alle Rechtsnormen sind, wenn sie denn aktiv in Erscheinung treten, „Richterrecht“, gleichgültig ob sie ihre Existenz einem Gesetz, einem Urteil, einer Gewohnheit oder einem sittlichen Postulat
verdanken.
Ferner erweisen sich die so genannten „Rechtsquellen“ bei dieser Perspektive als Topoi, d.h., als die Sitz- und Fundstellen für Argumente. Sie liefern Argumente dafür, warum der Entscheider diese
oder jene Norm als erste Prämisse in sein Subsumtionsmodell einfügen kann. Argumente haben die Aufgabe, Einverständnis zu beschaffen, wenn Positionen strittig geworden sind oder aus anderen
Gründen gerechtfertigt werden müssen.
Je stärker ein Argument, desto größer die Zustimmungsbereitschaft. Die Stärke eines Arguments kann von formalen oder von materialen Kriterien abhängen.
Ein Gesetz ist ein besonders starkes Argument, da es formal und sachlich in hohem Maße legitimiert ist und der Richter kraft Amtes nicht nur verpflichtet ist, es zu beachten, sondern ihm, wie
Hirsch richtig bekräftigt, den primären Respekt schuldet.
Ob es einem anderen, auf Vernunft, Natur oder Gott gestützten Argument gelingt, sich gegenüber dem Gesetz durchzusetzen, hängt dann davon ab und nur davon ob es die am Rechtsdiskurs Beteiligten zu
überzeugen vermag.
Es ist also nicht sinnvoll in essentialistischem Zorn auf Argumente einzudreschen, die nicht aus der Sphäre des positiven Rechts stammen. Vernünftig ist nur, das strikte Gesetzesbindungsdenken auf
den argumentativen Kampf um die richtige Norm umzuorientieren und diesen offen und teleologisch* auszufechten.
Erklärung von UHR:
Teleologie (altgr. τέλος télos ,Zweck, Ziel, Ende’ und λόγος lógos ,Lehre’) ist die Lehre, dass Handlungen oder überhaupt Entwicklungsprozesse an Zwecken orientiert
sind und durchgängig zweckmäßig ablaufen.[1] Der Begriff hat eine längere Vorgeschichte, der Ausdruck dafür wurde aber erst vom deutschen Philosophen Christian Wolff in seiner Philosophia
rationalis, sive logica (1728) eingeführt.[2]
Der Teleologie als Weltanschauung liegt die Annahme von entweder äußeren (transzendenten) oder inneren (immanenten) Zweckursachen zugrunde. Quelle = WIKIPEDIA
Des Weiteren wäre einzusehen, daß der Rechtsstaat immer schon ein Richterstaat war. Das ist schon historisch nicht zu bezweifeln. Wo immer wir hinschauen sehen wir Richter und Gerichte lange
bevor die ersten Gesetze auftauchen. Was inzwischen sichtbar wurde, ist nicht etwa ein Verfassungswandel, sondern es sind die wahren Verhältnisse. Die Verfassung gilt in der Form, in der sie
das Bundesverfassungsgericht als geltend beschreibt und wie das Unterverfassungsrecht zu verstehen ist, erklären uns die anderen oberen Gerichte des Bundes.
Wer daran zweifelt, geht nicht aufmerksam durch unsere Rechtswelt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich durch seine Deutung der einstmals gegen den Staat gerichteten Grundrechte als „Werte“
in die Lage versetzt, die gesamte ordentliche Gerichtsbarkeit anhand einer von ihm erfundenen objektiven Werteordnung zu kontrollieren, für die der Verfassungstext kaum mehr als einen symbolischen
sprachlichen Anhaltspunkt bietet.
Ob die Regierung außenpolitisch rechtmäßig handelt, wenn sie ihre Tornados nach Afghanistan schickt und innenpolitisch vernünftig, wenn sie die Pendlerpauschale kürzt, entscheidet heute nicht sie
selbst, sondern das (politisch zumindest mental eingebundene) Bundesverfassungsgericht, während die Regierung vor der Tür steht und auf ein günstiges Urteil hofft. Und der Präsident des
Bundesverfassungsgerichts läßt gelegentlich durchblicken, welche innenpolitischen Reformen mit seinem und seiner Richter Wohlwollen werden rechnen können und welche nicht.
Sogar so unüberwindlich scheinende und für eindeutig angesehene Regeln wie der Grundsatz nullum crimen, nulla poena sine lege konnte der Bundesgerichtshof bei den Mauerschützenprozessen mühelos
überwinden, indem er Vorschriften der Vergangenheit, die ein bestimmtes Verhalten nicht geboten haben, mit der Formel, daß sie es bei einem seinerzeit richtigen Verständnis sehr wohl geboten haben
würden, für seine spätere Bestrafung der für die Täter unerkennbaren Verstöße aufrüstete.
Daß bei den Instanzgerichten die Dinge nicht prinzipiell anders liegen, sondern nur hier und da durch gefestigte Routinen den Augen des (vielleicht auch müde gewordenen) Entscheiders verborgen
bleiben, sollte nicht zweifelhaft sein. Wo der suchende Blick des Urteilers keine Haltepunkte findet, was im Sozial-, im Arbeits-und Steuerrecht an der Tagesordnung ist, da ist die legislative
Tätigkeit ohnehin evident. Aber auch dort wo es sich anders zu verhalten scheint, wird die die Entscheidung determinierende Norm aus dem abstrakten Entscheidungsmantel herausgeschält und ins
normative Leben gesetzt.
V.
An der Existenz des Richterstaates ist also nicht eigentlich zu zweifeln. Ob dies wirklich ein Übel ist und warum, wäre zu prüfen:
Das Prinzip der Gewaltenteilung im traditionellen Verständnis ist zweifellos verletzt.
Nicht die Legislative entscheidet, was die Justiz binden soll, sondern die Justiz bestimmt selbst, wie und in welchem Umfang sie gebunden sein will. Die Gewalt, die vom Volke ausgehen sollte, geht
nicht mehr von seinen Repräsentanten aus, sondern wird von einer beamtenähnlichen Klasse verwaltet.
Was aber steht zu befürchten?
Die Verletzung des Prinzips als solchen wäre nur dann ein über die theoretische Fleckenlosigkeit hinausgehendes Übel, wenn bestimmte Funktionen des Prinzips unwirksam würden.
Das Prinzip der Gewaltenteilung steht im Dienste der Machtmoderation. Es soll nicht Macht verhindern, sondern einem Missbrauch der Macht vorbeugen.
Ein solcher Missbrauch wäre gegeben, wenn Willkür, also: Subjektivität, Laune, Parteilichkeit, Angst, Borniertheit und ähnliche Befindlichkeiten und Haltungen, den oben zitierten argumentativen Kampf
um die richtige Normprämisse determinieren oder sogar entscheiden würden.
Anders als die theoretische Reflektion sich selbst häufig vorgaukelt, ist der Richter bei diesem Kampf nicht etwa mit sich und seinem allfälligen inneren Monolog allein. Der Pianist sitzt niemals
allein am Klavier.
Er ist auch in der obersten Instanz immer dialogisch eingebunden in Gesetzgebung, Dogmatik, Präjudiz, Kollegen, Gegner, gesellschaftliche Wertvorstellungen, ökonomische Optionen, politische
Strömungen, die seine Argumente parieren, verstärken, konterkarieren. Da mag es denn sein, daß bei einer Entscheidung über Schrottimmobilien ein Zivilsenat des BGH gegen einen anderen kämpft, so daß
auch das schlichteste Gemüt erkennen muß, daß hier etwas anderes stattfindet als „Anwendung“ des Rechts. Oder daß bei der Frage nach dem Umfang der Offenlegungspflicht von Abgeordnetengehältern der
Senat des Verfassungsgerichts die Verfassungsmäßigkeit des entsprechenden Gesetzes je zur Hälfte bejaht und zur Hälfte verneint, so daß das kollektive Ringen um ein wechselseitiges Einverständnis vor
aller Augen abläuft und die ontologisierende Frage, was die Verfassung „will“ oder was verfassungsmäßig „ist“, durch die Geschäftsordnung entschieden wird.
Für „Willkür“ ist in diesem System angesichts der vielen hemmenden Elemente nur wenig Spielraum. Es scheint also kaum zweckmäßig sich auf das Jammern über die Verletzung eines Konzepts zu
konzentrieren, das in Frontstellung zur Willkürherrschaft des Absolutismus entwickelt wurde.
Die so genannten „Lehren“ der Vergangenheit sind aller Ehren wert. Als alle noch fest an die Gesetzesbindung glaubten, hat diese die Richterschaft nicht vor dem geistigen und moralischen
Absturz bewahrt.
Sie würde bei Wiederkehr jener Verhältnisse erneut versagen. Aber jene Verhältnisse kehren nicht wieder, weil die Verhältnisse niemals wiederkehren und sollte dies aufgrund göttlicher Willkür doch
einmal der Fall sein, würde der gegenwärtige Nichtglaube an die Möglichkeit der Gesetzesbindung den Untergang unserer Rechtskultur nicht beschleunigen.
Vernünftiger dürfte es daher sein, den Tatsachen ins Auge zu sehen und den aktuellen Richterstaat nicht unter einen ideologischen Generalverdacht zu stellen, sondern ihn zu festigen und zu
perfektionieren.
VI.
Institutionell gibt es dazu allerdings nicht sehr viele Möglichkeiten. Der gelegentlich geäußerte Gedanke an eine umfassende Richterwahl ist äußerst problematisch, weil die Richter, wie wir aus
anderen Ländern wissen, auf Kosten eines letztlich dürftigen Legitimitätsgewinns, mit dem ganzen politischen Plunder der Kandidatenkür, des Wahlkampfes, der Wahlversprechen, der Klientelbetreuung
usw. belastet werden, ohne daß sich die erwünschten Werthaltungen erzwingen ließen.
So richtig die Feststellung ist, daß aus dem Umstand, daß der Richter das Recht erzeugt, folgen müsse, daß er auch die Verantwortung dafür zu tragen habe, so wenig wird sich diese im
außerkriminellen Bereich einklagen lassen – es sei denn, ein Systemsturz bringe die gesamten Verhältnisse zum Tanzen.
Es bleibt also bei der Arbeit am historischen Großsymbol und Leitbild des gerecht Richtenden, bei der gesellschaftlichen Modellierung eines Richterbildes.
Vor knapp eineinhalb Jahrzehnten hat Regina Ogorek einmal die Wissenschaft aufgefordert,
„nicht auf dem komfortablen Sitz der Justizkritik einzurosten, sondern ein neues Richterbild zu entwerfen, das – unter Verzicht auf überkommene Leitideen – sein Profil nicht mehr aus den
Problemstellungen des Frühkonstitutionalismus, sondern aus den politischen und gesellschaftlichen Bedingungen der heutigen Zeit mit ihren veränderten Anforderungen und Verwirklichungschancen
erhält“.
Es scheint nicht, daß die Wissenschaft dieser Aufforderung gefolgt ist. Wer dazu beitragen will, daß die Pianisten sich im Großen und Ganzen an die Partitur halten, auch wenn sie eine Interpretation
spielen, die vielleicht nicht allen gefällt, hat also weiterhin kaum eine andere Möglichkeit, als die späteren Pianisten gut auszubilden, gut zu bezahlen, gut fortzubilden, angemessen zu respektieren
– und zu hoffen, die Investitionen möchten nicht vergebens gewesen sein.
Meine Gedanken dazu:
Es bräuchte keine ausgefeilten Gesetze,
die nur zur Verwirrung führen
und zur Falschauslegung verführen,
wenn es weise Richter gäbe.
in Kurzform:
Es braucht keine ausgefeilten Gesetze – nur weise Richter.
Ulrich H. Rose vom 07.10.2009
Veröffentlicht am 08.01.2011
P.S. die Genehmigung zur Veröffentlichung liegt mir von Prof. Dieter Simon vor.
Hier geht es weiter zu "Die 90:10-Regel von Ulrich H. Rose"